Konkrete Veränderungen erzielen. Das wurde uns als Ziel bereits in die Wiege gelegt. Und daran messen wir unsere Arbeit bis heute. Deshalb kann jede und jeder auch im Alltag die Ergebnisse unserer Arbeit spüren. Wussten Sie, dass die Deutsche Umwelthilfe dahintersteckt, wenn Sie Getränke in Mehrweg kaufen, für Einweglimo Pfand bezahlen, keine Einweg-Plastiktüten an der Kasse kostenfrei bekommen, Partikelfilter und Stickoxid-Katalysatoren in Diesel-Fahrzeugen eingebaut sind, Sie über den Energieverbrauch von Geräten informiert werden oder mit etwas Glück einem scheuen Fischotter begegnen? Nein? Dann können Sie hier erfahren, was wir mit all dem zu tun haben.

Konkret wirksam zu sein – das war den Gründern der DUH wichtig. Der Verhaltensforscher Prof. Dr. Gerhard Thielcke, Hermut Ruland, Rudolf L. Schreiber und Nikolaus von Bodman gründeten am 5. August 1975 die "Deutsche Gesellschaft zur Förderung des Umweltschutzes e.V." – später in Deutsche Umwelthilfe umbenannt. Die erste Geschäftsstelle entstand in Öhningen-Kattenhorn am Bodensee. Von 1975 bis 1988 war Hermut Ruland Bundesvorsitzender der DUH, ihm folgte bis zum Jahr 2001 Prof. Dr. Gerhard Thielcke. Sein Kernsatz „Prüfe alles, was Du tust darauf, was es wirklich für die Natur an Verbesserungen bringt“ machte deutlich: Es geht der DUH nicht um abstrakte Ideen oder schöne Worte für die Umwelt, sondern darum, dass wir konkrete Verbesserungen durchsetzen – für die Pflanzen- und Tierwelt und damit auch für uns Menschen. Es ist unser zentrales Leitmotiv bis heute und hat über die Jahrzehnte zu vielen Erfolgen geführt.
Tägliche Begleiter: Mehrweg-Flaschen und „Dosenpfand“

Ein Beispiel: Umweltschädliche Plastik-Einwegflaschen und Getränkedosen. Sie verdrängten seit den 1970ern die umweltfreundlichen Glas-Mehrwegflaschen. Dahinter steckten industrielle Großkonzerne der Getränkebranche und des Handels. Mit großer Umweltbelastung hergestellt, vermüllten sie zunehmend Innenstädte, Parkanlagen und die Natur. Und sie drohten das gut funktionierende, umweltfreundliche regionale Mehrwegflaschen-System zu verdrängen. Durch kreative Aktionen gelang es Anfang der 90er Jahre, Umweltminister Töpfer davon zu überzeugen, ein Einwegpfand gesetzlich zu verankern. Dieses sollte automatisch ausgelöst werden, wenn die Mehrwegquote im Getränkebereich gegenüber dem von Industrie und Handel versprochenen Status Quo von 72 Prozent unterschritten würde.
Mit einer mehrjährigen Kampagne und weiteren bildstarken Aktionen, wie der Einführung eines Dosenpfandes für fünf Tage in Berlin inklusive demonstrativer Sammlung von insgesamt 630.000 leeren Getränkedosen auf einem imposanten „Dosenberg“ gegenüber dem Bundesratsgebäude in Berlin, setzte die DUH 2003 das Dosenpfand durch – gegen den bis zum Schluss massiven Widerstand der Einweg-Getränkeindustrie und der großen Handelskonzerne. Ein Meilenstein gegen Müllberge.
Dieselpartikelfilter und Stickoxid-Katalysatoren in jedem Pkw

Dieselpartikelfilter und funktionierende Stickoxid-Katalysatoren finden sich heute in allen neuen Diesel- und Benzin-Pkws. Sie reduzieren krankmachende Stickoxidemissionen und den Ausstoß von Dieselrußpartikeln um bis zu 99%. 1998 verpesteten noch praktisch alle Verbrenner-Fahrzeuge die Atemluft – mit verheerenden Folgen sowohl für die Gesundheit der Menschen als auch für die Versauerung und Vergiftung der Natur. Die deutsche Autoindustrie wehrte sich mit all ihrem Lobby-Einfluss auf Politikerinnen und Politiker gegen eine Verschärfung der Abgasgrenzwerte, die nur mit Dieselpartikelfilter und NOx-Katalysatoren ehrlich eingehalten werden konnten. Wir zeigten in unserer 1992 gestarteten Kampagne "Kein Diesel ohne Filter" ganz praktisch und eindrücklich, welchen Unterschied Partikelfilter auch bei modernsten Dieselmotoren machten: Wir hielten einen Feinstaubfilter aus einem Staubsauger an einen Auspuff mit Partikelfilter – er blieb weiß. Dann hielten ihn an einen Auspuff ohne Filter – es glänzte binnen weniger Sekunden schwarz, so viel Dieselruß kam aus dem Auspuff heraus. Mit einem Papiertaschentuch übrigens kann man die Partikel nicht zurückhalten. Sie sind so klein, dass hindurchkommen, sich ganz tief in unseren Lungen ansammeln und zu schweren Atemwegserkrankungen führen. Nachdem die Autokonzerne für die vielen Mittelklasse- und Dieselkleinfahrzeuge die technische Unmöglichkeit eines Partikelfilters behaupteten, präsentierte die DUH 2004 einen Smart, den wir mit einem voll funktionstüchtigen Diesel-Partikelfiltersystem ausgerüstet hatten – eine Weltpremiere und der Beweis, dass der Einbau machbar war.
Verbraucher schützen, Verstöße jeden Tag aufdecken
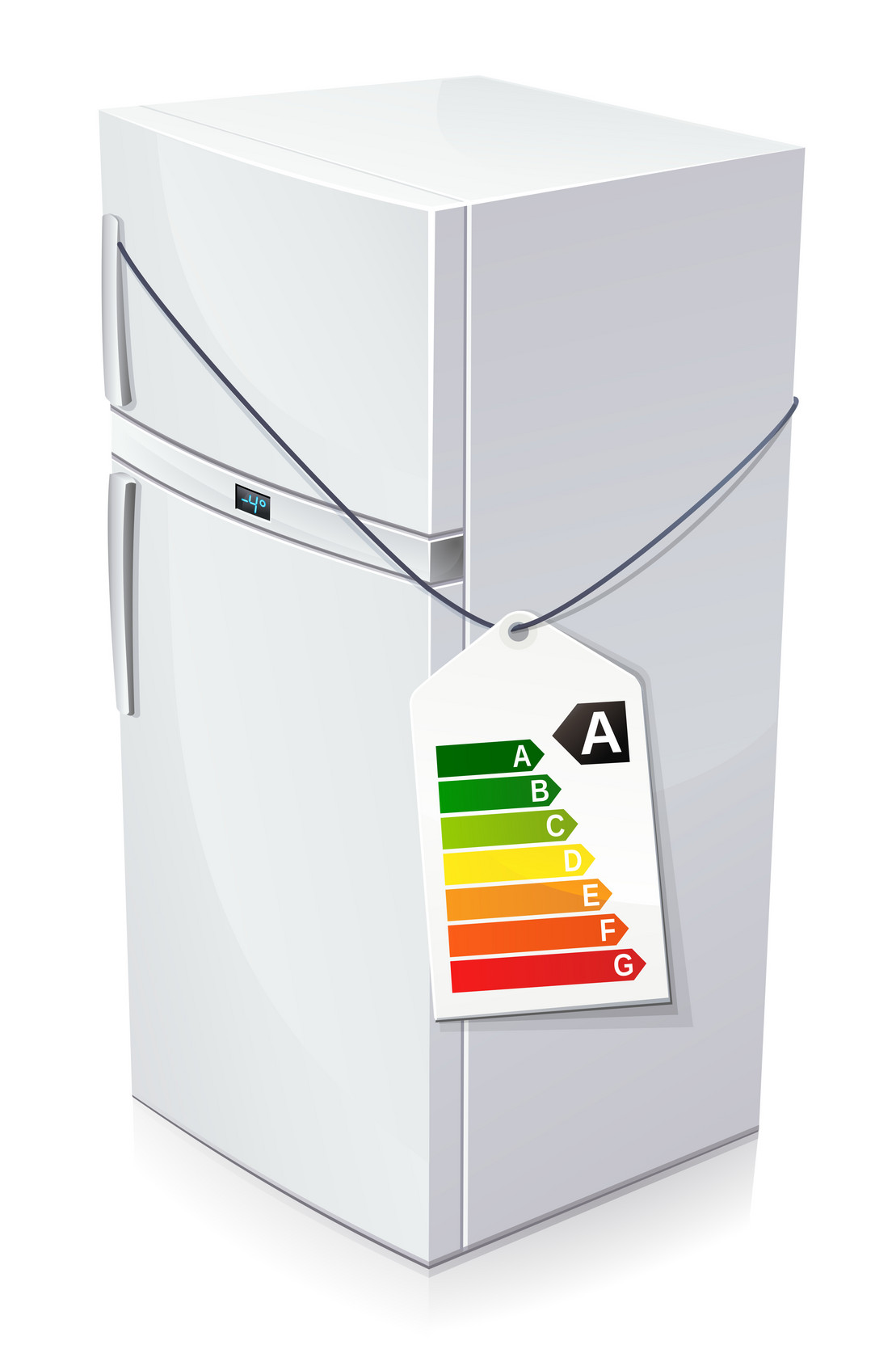
Energielabel mit Effizienzklassen von A bis G in grün bis tiefrot sollen allen Verbraucherinnen und Verbrauchern vor dem Kauf darüber informieren, ob der Kühlschrank, die Lampe, das Auto und viele weitere Produkte sparsam und umweltfreundlich sind. So sehen es EU-Verordnungen vor. Doch wer kontrolliert eigentlich, ob die Schilder korrekte Werte zeigen, oder ob sie überhaupt auf den Produkten angebracht sind? Schließlich ist es für Händler nicht besonders angenehm, groß und rot zu zeigen, dass das angepriesene Gerät in Wahrheit ein teurer Energie- und Geldfresser ist. Eigentlich ist diese Kontrolle die Pflicht der Marktüberwachungsbehörden der EU-Staaten. In Deutschland wird diese aber praktisch nicht erfüllt. Deshalb war 2004 ein wichtiges Jahr, um die Kontrolle der Einhaltung von umweltbezogenen Verbraucherschutzvorschriften zu starten. Wir beantragten beim Bundesamt für Justiz die Eintragung als klageberechtigter Verbraucherschutzverband und erhielten das Recht und die Pflicht, im Auftrag der Bundesregierung die Einhaltung von Verbraucherschutzvorschriften zu kontrollieren und Verstöße zu verfolgen. Alles Aufgaben, die eigentlich die Behörden erfüllen müssten, aber in Deutschland aufgrund des Druckes von Handel und Industrie auf die Regierungen nicht tun. In den vergangenen zwei Jahrzehnten zeigte sich, wie notwendig das war: Von 2004 bis 2025 haben wir über 25.000 Verstöße entdeckt und dafür gesorgt, dass die Regeln jetzt eingehalten werden.
Radwege eröffnen statt sperren

Viel zu wenige sichere Radwege, jahrelange Planungen, Vorrang für den Autoverkehr. Der Umstieg vom Auto aufs Fahrrad wird den Menschen in Deutschland schwer gemacht. Bei unseren Klagen für Saubere Luft erlebten wir, dass es oft sieben bis zehn Jahre dauert, bis ein neuer Radweg entsteht. Umso beeindruckender die Beispiele aus Berlin und Bogotá, als zu Beginn der Corona-Pandemie innerhalb weniger Wochen aus Autospuren einfach durch provisorische Markierungen und Abtrennungen sichere Pop-up-Radwege wurden. Genial und konkret, fanden wir und machten uns an die Umsetzung in ganz Deutschland. In wenigen Tagen als Aktion gestartet, stellten wir gemeinsam mit 4.000 Menschen aus ganz Deutschland in mehr als 200 Städten Anträge auf solche Radwege – äußerst erfolgreich, wie beispielsweise in Hamburg, Darmstadt oder München. Und wir sorgen bis heute dafür, dass bestehende Verbesserungen erhalten bleiben – notfalls per Eilverfahren vor Gericht. Zum Beispiel, wenn fertig gebauten Fahrradwegen aufgrund einer autozentrierten Verkehrspolitik die Umwandlung in Autoparkplätze droht, wie 2023 in Berlin-Reinickendorf. Mit einer Klage vor Gericht konnten wir diesen und viele weitere Radwege retten.
Einsatz für den Bodensee

Nachhaltiges Wirtschaften konkret: 1990 startete die DUH das Bodensee-Umweltschutzprojekt, bei dem modellhaft ein pestizidarmer Landbau, naturverträglicher Tourismus, eine andere Baupolitik und eine Verkehrsverlagerung auf die Schiene im Wassereinzugsgebiet des Sees erprobt und gefördert wurde. Ein großer Erfolg, der 1995 in die Gründung der länderübergreifenden Bodensee-Stiftung für Natur und Kultur mündete, die das Projekt bis heute weiterführt.
Netzwerke schaffen: Lebendige Flüsse und Seen

Auch der ehemalige Grenzfluss Elbe war für die DUH von besonderer Signalwirkung: Der DUH-Gründer und damalige Bundesvorsitzende Gerhard Thielcke stammte aus Köthen nahe der Elbe und engagierte sich intensiv im Rahmen des von uns gestarteten Netzwerks „Lebendige Flüsse“ für die Gesundung des zu DDR Zeiten mit Chemikalien stark belasteten Flusses. Es gelang, die deutsche und die tschechische Bundesregierung für eine Unterstützung dieses letzten auf viele hundert Kilometer natürlich verlaufenden und nicht durch Staudämme verunstalteten Stroms zu gewinnen. Mit „Elbe-Badetagen“, an denen über 100.000 Menschen teilnahmen, wurde für die Verbesserung der Wasserqualität und die Erhaltung der naturnahen Überschwemmungsflächen und Auwälder geworben. Heute besteht das Living Lakes Netzwerk aus 117 Partnern 55 Ländern auf allen Kontinenten.
Einmaliges Naturparadies: UNESCO-Welterbetitel für das Okavango-Delta

Auch international engagierte sich die DUH erfolgreich für den Erhalt der Natur: Nach jahrelanger DUH-Projektarbeit und in Kooperation mit der Regierung von Botswana gelang es 2014, dass die UNESCO das Okawango-Delta als eintausendstes Welterbe unter Schutz stellte. Das unglaubliche Natur- und Tier-Paradies zieht Menschen weltweit in seinen Bann – ist aber weiterhin bedroht. Internationale Öl- und Gaskonzerne versuchen immer wieder, Bohrungen in dem empfindlichen Ökosystem durchzuführen. Wir kämpfen weiter dagegen an – bislang erfolgreich.
Rettung für den Fischotter

Zurück nach Deutschland, aber ebenso konkret und kämpferisch: In Bayern konnten wir 2023 einer Tierart helfen, die im 20. Jahrhundert in Europa fast ausgerottet wurde und sich nun langsam wieder ausbreitet: dem Fischotter. Im Landtagswahlkampf wollte CSU-Ministerpräsident Markus Söder die streng geschützten Tiere einfach zum Abschuss freigeben. Per Eilverfahren konnten wir das buchstäblich im letzten Augenblick verhindern: Nur Stunden vor Beginn der Abschussfreigabe stoppten wir die Verordnung vor dem Verwaltungsgericht und retteten den Ottern das Leben. Später gewannen wir auch das Hauptsacheverfahren. Heute ist der Straßenverkehr die größte Gefahr für die niedlichen Mardertiere. Besonders an Brücken, an denen Straßen Gewässer kreuzen, sterben viele Tiere. Denn wenn Gewässer und Auen so verändert und verengt sind, dass die Tiere nicht mal mehr auf einem kleine Uferstreifen unter der Brücke hindurchwandern können, weichen sie über die Fahrbahn aus – was oft tödlich endet. Darum sorgen wir dafür, dass Brücken, die neu gebaut oder ersetzt werden, den Fluss möglichst weit überspannen und ein naturnahes Ufer aufweisen. Bei bestehenden Brücken schaffen wir mit Querungshilfen eine Übergangslösung. Diese Maßnahmen in Thüringen, Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland retten Otterleben und helfen, die Zusammenführung der Otterpopulationen in Europa zu ermöglichen.

